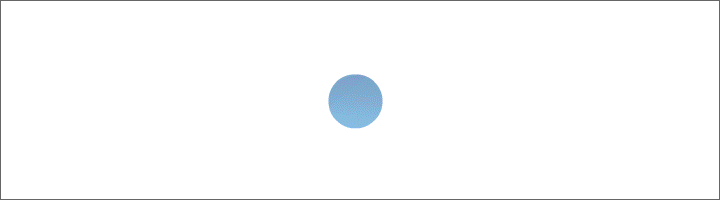Ein Umzugsunternehmen (wer hat es bestellt und bezahlt frage ich mich heute?) bringt Holz- kisten. In die kleineren soll ich schwereres packen, wie Geschirr und Bettwäsche, Bücher. Die größeren können mit leichteren Sachen (wie Schuhen z.B.) gefüllt werden. Auch Packpapier ist dabei. Mir bleiben ein paar Stunden. Um das Nachkriegsleben meiner Mutter transportierbar zu machen. Einige der Behälter bleiben leer. Es gibt nichts, um sie zu füllen. Was könnten eine Kü- che von 6qm und ein Schlafzimmer mit 12qm auch enthalten? Wenige Kellersachen kommen dazu, das war’s.
Meine Schultasche setze ich auf, gebe meiner Mutter die Handtasche mit den wichtigen Papieren in die Hand, als alles im kleinen LKW verschwunden ist und wir im Führerhaus mitfahren dürfen. Der Blick meiner Mutter geht ins Leere, als verstände sie nicht was geschieht, sei ihr alles egal. Der Fahrer redet also mit mir. Vermutlich, um die Stille zu durchbrechen. Seine Eltern waren auch Kriegsflüchtlinge. "Nicht alle haben verkraftet was geschehen ist", sagt er. Und wie gut es sei, dass ich so vernünftig wäre…
Gegen Mittag war alles vorbei, standen die Möbel aufgebaut. Die Umzugsmänner hatten ihre Pausenbrote dagelassen. Weil der Kühlschrank leer war. Meine Mutter lag im ehemaligen Ehe- bett wie an jedem Tag. Nur, dass es jetzt ganz woanders stand. In der Dortmunder Innenstadt, statt im Arbeitervorort. Hat sie es überhaupt bemerkt? Ich habe sie umgekleidet, ihr unter die Decke geholfen, das neue große Fenster mit einem Laken und Heftzwecken verdunkelt. "Wo sind wir denn? Ist alles gut?" Ich habe genickt und von der schönen neuen Wohnung erzählt. Ganz nah an der City, man höre die Glockenklänge der Reinoldi–Kirche, der Stadtpark sei um die Ecke und das schöne Schwimmbad, der Fernsehturm.
Seltsam. Ich sitze hier und tippe auf die schwarzen Tasten. Zum ersten Mal geht mir auf, dass dies sich oft in meinem Leben wiederholen wird. Zu beruhigen, abzuschwächen. Von jenem zu erzählen, was gut ist. Die Dunkelheit zu leugnen.
Vor meinen Augen entsteht das Bild vom Kathedralenplatz in Santiago 2007. Es ist der Abschied von Georg am Taxi mit laufendem Motor. Er weiß nicht wer ich bin und ich kenne seine Identität nicht. Wir werden uns nie wiedersehen. So glaube ich es jedenfalls fest, in diesem Moment. Und vielleicht hat mir eben gerade das damals ermöglicht Gefühle zuzulassen. Das tobende Herz in mir bezwang ich. Eine letzte Umarmung, sanft strich ich seine Tränen fort. "Weine nicht, mein Liebster, alles ist gut!" So war es schon fünfzig Jahre zuvor. Trösten. Ermutigen. Das Positive in den Fokus rücken. Wie könnte man auch sonst überleben?!
Nachdem ich alles ausgepackt habe laufe ich zu den Straßenbahn–Haltestellen. Mit Stift und Zetteln. Wann die Anschluss-Busse fahren lässt sich nicht feststellen. Also muss ich auf jeden Fall früh los, um Differenzen aufzufangen. Google hätte es mir leicht gemacht, aber daran ist vor fünfzig Jahren nicht zu denken. Wir haben nicht einmal einen Fernseher. Keine Zeitung. Kein Telefon. Das vermag man sich heute kaum vorzustellen. Aber so war es! "Versuch macht klug", so sagt der Volksmund. Durch Erfolg und Irrtum klären sich meine Fahrverbindungen binnen Ta- gen. Und es stellt sich heraus, dass ich mehr als drei Stunden täglich benötigen werde. An den Tagen mit nachmittäglichem Sport, oder Werkunterricht, bin ich mehr als zwölf Stunden von da- heim fort, verbringe die Mittagszeit, die ich abwarten muss, in Hauseingängen, auf Ruinen-grundstücken, die es immer noch in Massen gibt. Stets in der Sorge, wie es meiner Mutter geht. Ob sie schläft, gegessen hat?! Verkehrte Welt. Niemand sagt, dass die Innenstadt über mehrere, gut erreichbare Gymnasien verfügt. Es wäre nur ein Federstrich, mein Leben zu erleichtern. Aber keiner fragt nach. Ich mache ja keine Probleme. Also ist jedes Engagement wohl überflüssig.
Meine Mutter verkraftet den Umzug nicht. Sie hat keinen Plan für ihr Leben. Geschweige denn für meines. Oft muss ich den Arzt holen. Es ist der neue, junge nur ein paar Straßen weiter. We- gen der Abmagerung tippt er auf eine Krebserkrankung. Schreibt eine Einweisung fürs Kranken- haus. Ich laufe hin und regele die Aufnahme. Ein Krankenwagen nimmt meine Mutter mit. Ins Hospital, das eben gerade jenen Namen trägt, der so oft in meinem Leben eine Rolle gespielt hat: St.JOHANNES. Mich erstaunt jetzt, dass mir dies nie zuvor aufgefallen ist. Aber nun! Da ich mich schlagartig an alles erinnert habe, was ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Die heutigen Möglichkeiten genutzt habe, um Daten, Gegebenheiten, Anschriften und Namen von damals herauszufinden. Es war schockierend! Plötzlich erstanden Brücken, Verbindungslinien, öffneten sich Dokumente. Und ich verstand. Endlich!
Im Krankenhaus wird experimentiert. Untersucht. Vermutet. Überwiesen von Abteilung zu Abtei- lung. Damals funktioniert das noch wunderbar. Jeder Patient bedeutet bares Geld. Und wird da- her (solange es überhaupt nur geht) in einer Einrichtung behalten. Was in diesem speziellen Fall bedeutet: Dass es am Ende fast drei Monate sind, die ich allein in der Wohnung verbringe, wenn ich nicht gerade in der Schule, oder auf dem Weg bin, oder meine Mutter besuche. Sie gibt mir das Abendessen mit. Es sind Brote, die für mich medizinisch riechen, nach Krankheit. Manche esse ich, andere verfüttere ich an die Tiere im Park.
Ich bin unendlich einsam. Niemand fragt nach mir, kümmert sich um mich. Wenn ich das Kran- kenhaus verlassen muss, weil die Besuchszeit endet, vergrabe ich mich in meinen Schulsachen. Hole meinen geliebten Aktenordner hervor. Er sieht nach nichts aus, eben wie alle in jener Zeit. Dunkelgrau, fast schwarz. Die Eltern meiner Schulfreundin haben ihn mir großzügig aus ihrem aussortierten Kram zukommen lassen. Der Vater ist Bezirksvertreter einer Versicherung. Die Mut- ter dirigiert Familie und Putzfrau, spielt Klavier. Ständig schlecht gelaunt. Sie bewohnen eine er- erbte Villa und führen ein Leben des gehobenen Mittelstandes. Als Freundin der Tochter wurde ich quasi selektiert: "Suche aus, wer alle notwendigen Fähigkeiten für ein schulisches Fortkom- men besitzt!" Das war ich offensichtlich. Wir lernen und pauken. Dafür bekomme ich ein Mittag- essen (das ich fast nie mag), die ungeputzten schweren Silberbestecke schmecken auch eklig. Warum bin ich trotzdem immer wieder mitgegangen? Hab' mich beleidigen lassen? Standard- satz: "Wie kann ein Kind von solch' ungebildeten Unterschichteltern nur diese Zensuren erlan- gen?" Diese Menschen kamen ganz unbewusst der Wahrheit ziemlich nahe. Doch es dauerte noch viele Jahrzehnte, bis sie ans Licht kam.
Über Monate habe ich in der Angst geschwebt, was mit mir passieren würde, wenn meiner Mut- ter etwas geschähe. Dürfte ich in der Wohnung verbleiben? Wie organisiert man eine Beerdi- gung? Wovon lebt man? Ich bin ein Kind. Nicht in der Lage mir Kenntnisse dieser Art anzueig- nen. Wo könnte ich nachfragen? Niemand rät mir.
Was mir bleibt? Mein Ordner. INDIEN. Wie an Bilder dafür kommen? "Reisekataloge", sagt je- mand. Immer wieder gehe ich vor Reisebüros auf und ab, versuche Mut zu schöpfen. Manchmal stundenlang. Schaue durchs Schaufenster. Überlege was ich sagen könnte. Ich sehe nicht aus, als könnten meine Eltern eine Fernreise bezahlen. Ich schäme mich. Habe nicht den Mut, ein- fach hinein zu gehen und zu fragen. Ob sie mir etwas mitgeben könnten, für die Schule. So wa- ge ich mich erst hinein, an einem Nachmittag mit Kundenansturm. Nehme mir rasch von Stapeln Kataloge. Fliehe. Sitze daheim mit klopfendem Herzen, schneide Bilder aus. Von Tempeltänzerin- nen mit geheimnisvollem Schmuck, Elefanten voller bunter Bemalungen und Palästen von Rad- schas aus "tausendundeiner Nacht". Ein einsames Kind flüchtet sich in Träume von Abenteuern, Ferne, Zauber und Geheimnissen…
Nicht ahnend, dass ausgerechnet all' dies ein halbes Jahrhundert später
für eines seiner eigenen Kinder die Zukunft verändern wird…
"Von der Hand die Deine berührt darfst Du niemals träumen..."
Und genau deshalb ist es heute, wie es eben ist.